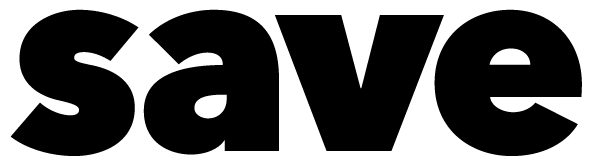Automatisiertes Fahren: Chancen und Risiken
Das automatisierte Fahren revolutioniert den Strassenverkehr. Die Assistenz- und Automatisierungssysteme sollen Sicherheit und Komfort erhöhen – bringen aber auch neue Herausforderungen mit sich. Und die Frage: Wie viel Vertrauen und Verantwortung darf man den Systemen überlassen?
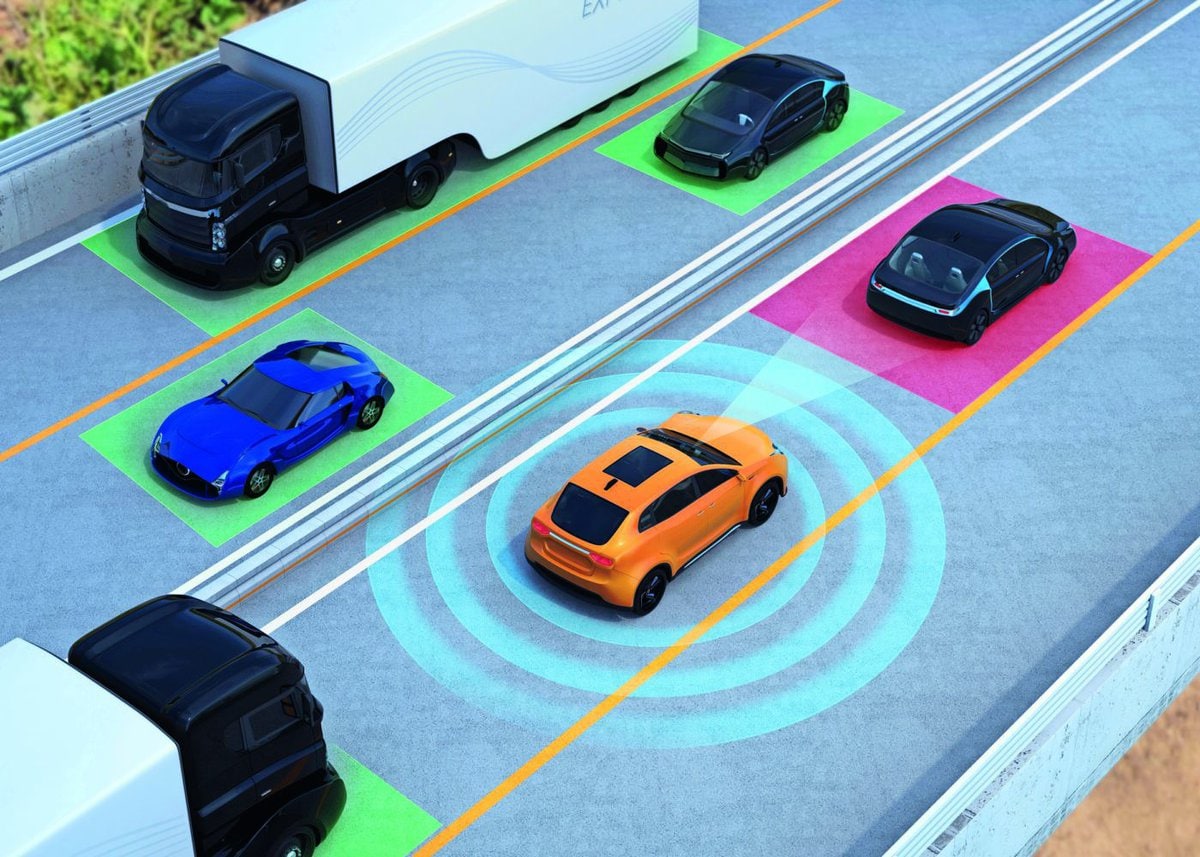
Das automatisierte Fahren wird den Strassenverkehr grundlegend verändern. Bereits heute sind zahlreiche Fahrerassistenzsysteme (FAS) im Einsatz. Systeme wie Notbremsassistenten, der Notfall-Spurhalteassistent oder der Totwinkelwarner sind immer verbreiteter und für alle neuen Fahrzeuge in der Schweiz bereits gesetzlich vorgeschrieben. Ihr präventiver Nutzen gilt als wissenschaftlich belegt. Den hohen präventiven Nutzen betont die BFU explizit in ihrem Präventionsportal Sinus plus (sinus-plus.ch): «Aktive Sicherheitstechnik in Fahrzeugen hat ein hohes Präventionspotenzial. Sie warnt oder greift in gefährlichen Situationen ein und kann so Unfälle verhindern».
Neue Anforderungen an Verkehrsteilnehmende
Parallel dazu gewinnen Systeme an Bedeutung, die dauerhaft beim Lenken, Bremsen und Beschleunigen unterstützen (Automatisierungsstufe 2) oder diese Aufgaben zeitweise sogar ganz übernehmen (Automatisierungsstufe 3). Solche «Fahrzeuge der Automatisierungsstufe 3» sorgen in erster Linie für mehr Fahrkomfort, zum Beispiel auf langen Autobahnfahrten. Sie stellen aber auch neue Anforderungen an die Verkehrsteilnehmenden, insbesondere an das Systemverständnis, das fortlaufende Verständnis der aktuellen Verkehrslage und die jederzeitige Übernahmebereitschaft.
Mit zunehmender Entwicklung dieser Technologien steigt auch der Bedarf nach klaren Regeln. Die Schweiz hat diesbezüglich 2025 mit der Verordnung über das automatisierte Fahren einen wichtigen Schritt gemacht: Fahrzeuge mit Übernahmefunktion dürfen unter bestimmten Bedingungen auf Autobahnen eingesetzt werden – erstmals ist es erlaubt, die Hände zeitweise vom Steuer zu nehmen. Die Entwicklungen bringen neue Chancen – aber auch neue Herausforderungen. Etwa durch übersteigertes Vertrauen in die Systeme, nachlassende Wachsamkeit und die Schwierigkeit, in kritischen Momenten angemessen zu reagieren.
Dieser Artikel fokussiert bewusst auf die Stufe 3, bei der teilweise die Fahraufgabe übernommen wird. Es ist die sicherheitsrelevanteste Übergangsform zwischen manuellem Fahren und Vollautomatisierung, in der sich technische, rechtliche und menschliche Anforderungen besonders verdichten.
Was ist erlaubt – und was (noch) nicht?
Einerseits eröffnet die Technik neue Möglichkeiten für Innovationen im Mobilitätssektor und schafft Komfort und Entlastung für die Fahrzeuglenkenden. Andererseits wirft sie praktische und rechtliche Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die zulässige Ausführung sogenannter fahrfremder Tätigkeiten.
Die Kernfrage lautet: Was ist erlaubt, während die Fahraufgabe gerade automatisiert vom Fahrzeug durchgeführt wird? Diese Frage bleibt in der Verordnung zurzeit noch unbeantwortet – sie lässt offen, welche konkreten Handlungen zulässig sind.
Gratwanderung bei fahrfremden Tätigkeiten
Diese regulatorische Zurückhaltung ist nachvollziehbar und spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider: Automatisierte Fahrzeuge sind derzeit nicht in der Lage, ausreichend lange Zeitfenster für eine sichere Rückübernahme bei intensiver Ablenkung zu gewährleisten. Solche prädiktiven Funktionen wären jedoch notwendig, um die Verantwortung kontrolliert und regulatorisch konkreter definiert abzugeben und Nutzerinnen und Nutzern tatsächlich mehr Handlungsspielraum zu ermöglichen.
Für Fahrzeuglenkerinnen und -lenker entstehen dadurch neue Unsicherheiten im Umgang mit solchen Systemen und ein sicherheitsrelevantes Dilemma. Die Unsicherheit: Ihnen fehlt eine prospektive Orientierung. Sie können nicht von vornherein mit Sicherheit wissen, welche Handlungen erlaubt sind. Im Ereignisfall entscheidet ein Gericht über die Angemessenheit der durchgeführten fahrfremden Tätigkeiten.
Das Dilemma: Einerseits sind sie formal von der Überwachungspflicht entbunden und dürfen sich im Rahmen der Vorgaben fahrfremden Tätigkeiten widmen, riskieren dabei aber, im Ernstfall nicht rechtzeitig eingreifen zu können. Wie stark eine Tätigkeit die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt, ist nur schwer einzuschätzen. Dennoch müssen Fahrzeuglenkende laufend beurteilen, was sie sich in der konkreten Situation «zutrauen» – und laufen dabei Gefahr, ihre eigene Leistungsfähigkeit zu überschätzen.
«Die Entwicklungen bringen neue Chancen – aber auch neue Herausforderungen. Etwa durch übersteigertes Vertrauen in die Systeme, nachlassende Wachsamkeit und die Schwierigkeit, in kritischen Momenten angemessen zu reagieren.»
Der Umgang mit fahrfremden Tätigkeiten wird damit zur Gratwanderung: Was ist noch unproblematisch, was bereits riskant? Wohin mit den Händen – ausser in den Schoss? Die bestehende Unklarheit erschwert einen sicheren und standardisierten Umgang mit der Technik.
Wie sich in der Praxis mit diesen Unsicherheiten umgehen lässt, wird sich mit zunehmender Erfahrung – und letztlich durch erste Präzedenzfälle in der Rechtsprechung – zeigen. Bis dahin gilt: Wer künftig Level 3 fährt, darf offiziell wenig – und fährt am sichersten, wenn er oder sie möglichst keinen fahrfremden Tätigkeiten nachgeht.
Fahrausbildung als ergänzender Baustein für sichere Systemnutzung
Technik allein macht den Verkehr nicht sicherer. Ihre Wirkung entfaltet sich erst im Zusammenspiel mit kompetenten, gut geschulten Fahrzeuglenkenden –besonders bei der Nutzung von Fahrzeugen mit Automatisierungssystemen. Die Fahrausbildung übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Obwohl Fahrzeuglenkende immer weniger aktiv tun müssen, kommen immer mehr und nicht minderanspruchsvolle Anforderungen hinzu – etwa im Hinblick auf das Verständnis dafür, was das eigene Fahrzeug tatsächlich kann und wo seine Grenzen sind. Auch eine realistische Selbsteinschätzung und eine situativ angemessene Reaktion sind Herausforderungen. Ist die Fahrausbildung, wie wir sie kennen, dafür überhaupt noch geeignet?
Seit Juli 2025 sind Fahrerassistenz- und Automatisierungssysteme verbindlich in die Ausbildung integriert. Künftige Fahrzeuglenkende sollen nicht nur lernen, wie die Systeme bedient werden, sondern auch, wann und warum sie ihnen nicht blind vertrauen dürfen. Ziel muss es sein, ein realistisches Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen der Technik zu vermitteln – und die Fähigkeit zu stärken, sicher und verantwortungsvoll zu handeln.
Langfristig wird es auch darauf ankommen, erfahrene Lenkerinnen und Lenker für diese Veränderungen zu sensibilisieren – etwa durch praxisorientierte Weiterbildungsangebote. Nur wenn alle Verkehrsteilnehmenden die neuen Technologien ausreichend kennen und kompetent nutzen, kann das Potenzial der Automatisierung tatsächlich ausgeschöpft werden – und zwar so, dass Komfortgewinne nicht auf Kosten der Verkehrssicherheit gehen.
Und dann fahren wir führerlos
Führerlose Fahrzeuge (Automatisierungsstufe 4) übernehmen die Fahraufgabe vollständig, jedoch nur auf kantonal bewilligten Strecken. Sie verkehren bereits heute in Pilotprojekten in der Schweiz. Anders als bei Stufe 3, ist hier keine Rückfallebene Mensch mehr vorgesehen. Damit steigen die Anforderungen an Systemzuverlässigkeit, gut ausgebaute Infrastruktur und gesellschaftliche Akzeptanz erheblich.
Perspektivisch wird der Einsatz solcher Systeme vor allem im Rahmen kommerzieller Mobilitätsangebote erfolgen – etwa im öffentlichen Verkehr oder in der Logistik. Für den privaten Individualverkehr scheint die Automatisierungsstufe 4 vorerst weniger relevant, nicht zuletzt aufgrund des hohen technischen und wirtschaftlichen Aufwands. Allerdings könnten neue Geschäftsmodelle – etwa führerlose Sharing-Flotten – dazu führen, dass auch im motorisierten Individualverkehr erste Anwendungen entstehen.
Welche Rolle der Mensch im automatisierten Verkehr künftig einnimmt, hängt wesentlich davon ab, inwieweit es gelingt, automatisierte Systeme technisch verlässlich zu gestalten, rechtlich einzuordnen und zugleich sicher in reale Verkehrskontexte zu integrieren.