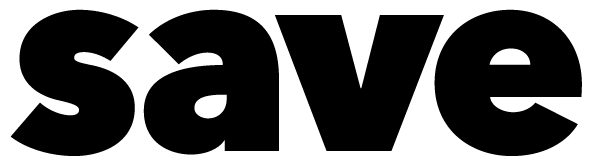Forschung für die Gesundheit mit innovativen Materialien: «Man muss das gesamte System ‹Mensch› verstehen»
Was das Besondere an der Forschung im Gesundheitsbereich an der Empa ist, was das mit Materialien zu tun hat und auf welche Themen sich die Empa-Forschung konzentriert, erläutert René Rossi, Co-Leiter des Departements «Materials meet Life» und des Forschungsschwerpunkts Gesundheit, im Interview.
Warum betreibt ein Materialforschungsinstitut wie die Empa eigentlich biomedizinische Forschung?
Laut einer EU-Studie sind rund 70% aller Innovationen materialgetrieben. Es gibt also zahlreiche wichtige Anwendungsfelder für neue Materialien, unter anderem eben im Gesundheitsbereich. Nehmen wir zum Beispiel ein Implantat: Das soll möglichst lange halten, man will Infektionen vermeiden, und die Oberflächenbeschaffenheit soll sicherstellen, dass es zu einer möglichst guten Integration ins Knochengewebe kommt, etwa bei einer künstlichen Hüfte – alles hochkomplexe Themen, die enorm viel materialwissenschaftliches Knowhow benötigen.
Was zeichnet Empa-Projekte im Gesundheitsbereich aus – was ist das Besondere?
In der Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern sehen wir häufig einen «Push-Pull»-Prozess, der getriggert wird durch einen intensiven Dialog. Die erfolgreichsten Projekte sind diejenigen, die im Wechselspiel mit unseren Spitalpartnern unmittelbar im klinischen Umfeld entstehen. Wir zeigen dabei die technologischen Möglichkeiten neuer Materialien auf, unsere Partner sagen uns, wo der Schuh im klinischen Alltag drückt. Sie wissen zwar genau, wo sie Probleme haben – aber oft nicht, dass es für manches bereits Lösungsansätze gibt. Dieser intensive Austausch ist absolut zentral – und dafür muss man sich Zeit nehmen, um Vertrauen und ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Das war auch für uns anfangs ein Lernprozess.
Ausserdem sind viele unserer Partnerschaften, gerade im klinischen Bereich, langfristig angelegt. Das erlaubt es uns, Technologien über verschiedene Reifegrade hinweg zu entwickeln, man spricht vom Technology Readiness Level» (TRL), vom ersten Prototyp im Labor bis zur marktreifen Lösung, die unsere Partner nutzen und umsetzen können. Deshalb pflegen wir strategische Partnerschaften mit ausgewählten Zentren, etwa mit dem Kantonsspital St. Gallen sowie mit den Universitätsspitälern in Zürich und Bern. Und drittens sind unsere Projekte hochgradig interdisziplinär.
Was verstehen Sie darunter, wie wird das an der Empa gelebt?
Für uns heisst das, ein Problem aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln anzugehen, nur so kann man das Potenzial für wirklich Neues erkennen. Dafür sind wir als Empa mit all den Natur- und Ingenieurwissenschaften unter einem Dach – von Nanotechnologie und Oberflächenanalytik, Textil- und Fasertechnologien, Molekular- und Zellbiologie bis hin zu Biomechanik und Modellierung – natürlich prädestiniert. Auf der anderen Seite sind auch die modernen Gesundheitstechnologien vom Wesen her Systemwissenschaften, die zig Disziplinen vereinen. Man muss das gesamte System «Mensch» verstehen, um effektive Lösungen im Gesundheitsbereich zu entwickeln – von der molekularen Ebene bis zur Physiologie des menschlichen Körpers inklusive psychologischer und soziologischer Aspekte.
Wie muss man sich ein typisches Empa-Produkt für klinische Anwendungen vorstellen?
Ein Beispiel sind «smarte» Wundverbände. Wundheilungsprozesse sind enorm komplex und verlaufen in verschiedenen Phasen; der Wundverband muss die verschiedenen Phasen – idealerweise – optimal begleiten, vor allem in der Infektionsphase, die man frühzeitig erkennen und behandeln muss. Dabei müssen wir vor allem verhindern, dass eine Wunde chronisch wird. Und später sollte der Verband den Heilprozess unterstützen und beschleunigen.
Ein damit verwandtes, sehr aktuelles Thema ist die weltweit zunehmende Antibiotika-Resistenz. Um dem nicht weiter Vorschub zu leisten, sollten wir Antibiotika nur dann einzusetzen, wenn sie absolut notwendig sind – wir müssen also Infektionen möglichst rasch erkennen, etwa via Sensoren, die dann zum Beispiel über eine Farbänderung am Verband einen Bakterienbefall anzeigen. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen, alternativen Therapieansätzen, etwa «lebende» Materialien wie Bakteriophagen – also Bakterien-tötende Viren, die für den Menschen harmlos sind – oder Probiotika, also «gute» Bakterien. Und auch die sollten wir nur dann «aktivieren», wenn die Wunde tatsächlich infiziert ist, etwa indem wir sie in bestimmte Polymere verkapseln, die ihren Inhalt nur dann freisetzen, wenn beispielsweise der pH-Wert in der Wunde steigt, ein Frühindikator für eine Infektion. Ein Wundverband, der all diese verschiedenen «Fähigkeiten» vereint, wäre so ein typisches Empa-Produkt.
Mit dem Thema Gesundheit assoziiert man immer auch Kosten. Wo sehen Sie Möglichkeiten, die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen?
In erster Linie in der Prävention und Früherkennung. Die Gesundheitskosten steigen vor allem in den letzten Jahren des Lebens stark an. Ein möglicher Ansatz wäre, ältere PatientInnen mit Hilfe tragbarer Sensoren und ihrer digitalen Zwillinge optimal begleiten und unterstützen zu können. Der digitale Zwilling könnte aufgrund der übermittelten Sensordaten – falls nötig – personalisierte Therapien vorschlagen. Ausserdem haben verschiedene Studien festgestellt, dass bis zu 50% aller Therapien nicht korrekt angewendet werden. Wenn wir durch ein verbessertes «Health Monitoring» die Therapiesicherheit, aber auch die Compliance – und damit letztlich den Therapieerfolg – steigern könnten, wäre viel gewonnen.
Ein Blick in die Zukunft: Was hätten Sie in fünf bis zehn Jahren gerne mit Ihrer Forschung erreicht?
Seit 2023 haben wir an der Empa drei «Booster»-Programme gestartet, zum Beispiel für eine verbesserte Krebsbehandlung, die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen und eins zum Thema Wundheilung. Ein Wundverband, dank dem sich Wundinfektionen und vor allem chronische Wunden vermeiden liessen, etwa bei Paraplegikern und bettlägerigen Menschen, aber auch bei Neugeborenen, die aus irgendeinem Grund auf der Intensivstation liegen – das wäre ein toller Erfolg.
Und in der Demenzforschung, um ein anderes Beispiel zu nennen, wäre es ein Riesen-Fortschritt, wenn wir die ersten Anzeichen einer Erkrankung mit Hilfe einfacher Diagnostik, etwa über die Analyse von Bewegungsmustern, Vitalparametern wie Herz- und Atemfrequenz, Körpertemperatur, Blutanalysen, etc. bereits im Anfangsstadium erkennen könnten. Denn je früher man bei degenerativen Erkrankungen einschreitet – was derzeit leider noch nicht möglich ist –, desto eher kann man den Krankheitsverlauf zumindest verlangsamen.
Quelle: Empa