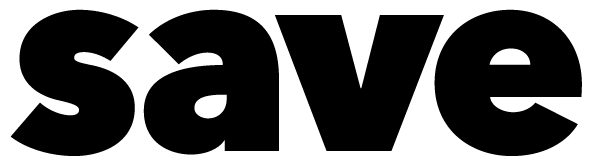Sicherheitsschuhe mit neuer Kennzeichnung
Geeigneter Fussschutz bei der Arbeit beugt nicht nur Fussverletzungen vor. Er mindert auch das Risiko für Rutsch- und Stolperunfälle. Die Qualitätsanforderungen an Arbeitssicherheitsschuhe sind standardisiert. Eine Überarbeitung der massgeblichen Norm bringt Änderungen bei der Kennzeichnung einiger Schutzeigenschaften mit sich.

O b auf der Baustelle oder in der Fabrikhalle, im Lager oder in der Werkstatt – der Schutz der Füsse durch Sicherheitsschuhe ist an vielen Arbeitsplätzen unverzichtbar. Dieser Fussschutz gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA), d.h., der Arbeitgeber muss geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass dies bei Mängeln oder Verschleiss umgehend ersetzt wird. In vielen Branchen und Unternehmen ist das Tragen von Sicherheitsschuhen längst selbstverständlich. Dazu beigetragen hat, dass heutige Sicherheitsschuhe nur wenig mit den ehemals klobigen Tretern gemein haben. Der Markt bietet heute eine breite Produktpalette mit attraktiven Modellen für viele unterschiedliche Einsatzzwecke.
Neue Buchstabenkürzel für spezifische Schutzeigenschaften
Mit der Modellvielfalt wächst jedoch die Qual der Wahl. Denn auch der beste Sicherheitsschuh kann nur dann optimal schützen, wenn er nicht nur seinem Träger passt, sondern auch passend zu den Risiken und Gefahren der Arbeitsumgebung gewählt wurde. Wer Fussschutz verwendet oder gar für die Kolleginnen und Kollegen beschafft, sollte daher die Kennzeichnung der Schuhtypen «lesen» können.
Massgeblich für die vielfältigen Anforderungen an Sicherheitsschuhe ist die Norm EN ISO 20345. Dieser Qualitätsstandard wurde nach einer Revision im Juni 2022 neu veröffentlicht. Einige der Änderungen wirken sich auch auf die Kennzeichnungsvorgaben aus. Denn die Schutzeigenschaften eines Sicherheitsschuhs werden durch Buchstaben codiert und bei neueren Schuhmodellen kommen neue Kurzzeichen hinzu. Unterschieden werden wie bisher Grundanforderungen, die jeder Sicherheitsschuh erfüllen muss, von den optionalen Zusatzanforderungen je nach Einsatzzweck.
Folgende Neuerungen sind für die Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen relevant:
- Die frühere «Durchtrittsicherheit» wird durch «Widerstand gegen Durchstich» mit den drei Kategorien P, PL und PS ersetzt.
- Neu sind die Zusatzanforderungen für Überkappen (SC) und für den Halt auf Leitern (LG).
- Die Resistenz gegen Öl und Benzin wird mit dem Kürzel FO angegeben.
- Beim Nässeschutz wird die bisherige Zusatzanforderung WRU umbenannt in WPA.
Die Tabelle liefert eine Übersicht der alten und neuen Abkürzungen, sortiert nach Schutzkategorien. Kennt man die zugrunde liegenden englischen Begriffe, lassen sich die Kürzel leichter merken.
Rutschhemmung wird zur Grundanforderung
Etwas komplizierter wird es bei der Rutschhemmung. Bisher wurde diese mit verschiedenen Methoden ermittelt und mit den Kürzeln SRA, SRB oder SRC angegeben. Diese drei Kategorien fallen nun weg. Stattdessen wird eine basale Rutschhemmung – ermittelt mit einer seifenartigen Lösung auf Bodenfliesen – zur Grundanforderung. Eine weitere rutschhemmende Eigenschaft – ermittelt auf Keramikfliesen mit Glycerin – kann als Zusatzanforderung mit SR angegeben werden.
Wer in der Tabelle das Kürzel ESD (electrostatic discharge) vermisst, sei darauf verwiesen, dass dafür nicht die EN 20345, sondern die Normung zur Elektrostatik (IEC 61340) relevant ist. Trägt ein Schuh das Kürzel ESD, bedeutet dies, dass der Schuh elektrostatische Ladungen über die Schuhsohle ableitet. Dies soll verhindern, dass empfindliche elektronische Bauteile durch kleine Entladungen – wie sie bereits beim Schlurfen über Teppichboden entstehen – beschädigt werden.
Neue Schutzklassen für Wasserdichtheit
Neben geänderten Grundanforderungen für die Zehenschutzkappe hat die Normrevision auch die zwei neuen Schutzklassen S6 und S7 festgelegt. Sie treffen zu, wenn der gesamte Schuh wasserdicht ausgerüstet ist, z.B. durch eine Membran. Damit sind die Klassen S6 und S7 mit den bisherigen Kennzeichnungen «S2 WR» und «S3 WR» vergleichbar.
Ebenfalls geändert haben sich die Anforderungen an das orthopädische Zurichten von Sicherheitsschuhen. Dies dürfte eher für Orthopädieschuhmacher relevant sein, die einen Sicherheitsschuh anpassen, wenn dies aufgrund von Fusserkrankungen oder Fehlstellungen notwendig wird. Betroffene sind gut beraten, vorab zu klären, wer diese Zusatzkosten übernimmt; das kann die Unfallversicherung, die Invalidenversicherung oder die Krankenkasse sein.
Massgeblich sind die Risiken vor Ort
Bei all den komplexen Schutzeigenschaften wäre mancher für eine Liste dankbar, die vorgibt, an welchem Arbeitsplatz und bei welchen Tätigkeiten welcher Schuhtyp mit welchen Kürzeln zu tragen ist. Eine rechtssichere Übersicht gibt es nicht. Massgeblich ist stets die konkrete Arbeitssituation vor Ort, d.h. die bestehenden Gefährdungen, die Bodenbeschaffenheit usw. Hilfreich ist eine Liste der DGUV (s. Praxistipp).
Dieser Artikel erschien zuerst in der Ausgabe 2/24 von SAVE.