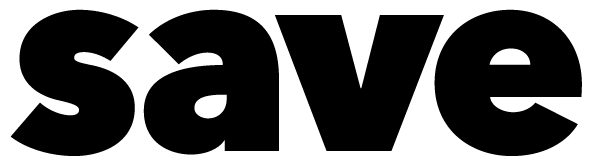Warum uns Stress krank macht
Dauerstress mindert unsere Lebensqualität. Mit möglicherweise irreversiblen Folgen: Denn Stress wirkt sich langfristig auf die Gesundheit aus. Das neue Flagship-Projekt «Stress» von Hochschulmedizin Zürich will Ursachen erforschen und Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Dass Stress krank machen kann, ist längst bekannt. Weniger bekannt ist, dass nicht nur die Psyche unter negativem Dauerstress leidet, sondern auch der Körper. «Chronischer Stress, insbesondere wenn er in der Kindheit erlebt wird, ist ein Risikofaktor für die Entwicklung häufiger neuropsychiatrischer oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren Leben», sagt Isabelle Mansuy, Professorin für Neuroepigenetik an der Universität Zürich und der ETH Zürich.
Isabelle Mansuy leitet zusammen mit Birgit Kleim, Psychologieprofessorin an der Universität Zürich, das neue grosse Flagship-Projekt von Hochschulmedizin Zürich (HMZ), das den schlichten Namen «Stress» trägt. Das Projekt wird am 1. Mai starten und wird mit einer Million Franken unterstützt, wobei sich ETH und Universität Zürich die Kosten teilen. Einem fünfköpfigen Steering Committee gehören Professorinnen und Professoren der UZH und der ETH an. Unlängst wurde das Projekt am Jahresanlass von HMZ feierlich lanciert.
Zweck des Flagship-Projekts «Stress» ist es, die Auswirkungen von Stress auf die geistige und körperliche Gesundheit zu verstehen, zu diagnostizieren und zu behandeln. An der Forschungskooperation beteiligen sich Forschende der ETH, der Universität, der Psychiatrischen Universitätsklinik und des Universitätsspitals Zürich. Sie widmen sich damit einem gesellschaftlich gravierenden Problem, denn Stress als solches hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen und erreichte wohl mit der Covid-Pandemie einen Höhepunkt.
Eines von vier Kindern betroffen
Generell wird zwischen gesundem Eustress und ungesundem Disstress unterschieden. Während Eustress die Leistungsfähigkeit kurzfristig steigert und gut bewältigt werden kann, mindert Disstress die Gehirnleistung, belastet das Immunsystem und macht auf Dauer krank.
Wenn wir Stress haben, stellt sich der Körper auf eine akute Gefahrensituation ein. Es werden Adrenalin, Noradrenalin und Corticoide ausgeschüttet, die Herzfrequenz und die Durchblutung steigen, Glukose wird freigesetzt und die Magendarmtätigkeit eingeschränkt. Es ist ein unwillkürliches Reaktionsmuster, das sich im Lauf der Evolution entwickelte: In einer Gefahrensituation stellt sich der Körper auf Flucht oder Kampf ein. Dabei greift bei Dauerstress das Cortisol wichtige Gehirnzellen an. Die Stresshormone führen dann langfristig sogar zu physiologischen und anatomischen Veränderungen im Hirn.
Stress kommt auch in der Kindheit häufig vor – verursacht zum Beispiel durch physischen oder sexuellen Missbrauch. Schätzungen der WHO zufolge ist weltweit eins von vier Kindern von Stress betroffen – die negativen Folgen wirken sich über die gesamte Lebensspanne hinweg aus. Denn Stress ist ein Risikofaktor für chronische Krankheiten, darunter psychiatrische, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ II bis hin zu neurologischen Erkrankungen wie Demenz. Komorbidität, bei der gleichzeitig mehrere Krankheiten auftreten, ist charakteristisch für Menschen, die schwerem Stress ausgesetzt sind.
Fachgrenzen überspannen
Trotzdem werden psychiatrische und kardiovaskuläre Erkrankungen nur selten gesamtheitlich betrachtet. Dies ist zum Teil auf die traditionelle Trennung von Psychiatrie und Kardiologie zurückzuführen. Hier setzt das neue Flagship-Projekt von HMZ an. Das Stress-Konsortium bringt Expertinnen und Experten aus den Bereichen Psychiatrie/Psychologie, Neurowissenschaften, Zell- und Molekularbiologie, Kardiologie, Ingenieurwissenschaften und translationaler Bioinformatik zusammen, um das Risiko und die Resilienz von Stress über den gesamten Lebensverlauf hinweg zu untersuchen. «Methodisch werden Langzeitstudien an Personen durchgeführt, die Stress ausgesetzt waren, und es werden Tiermodelle von Stress für mechanistische Studien verwendet.», erklärt Isabelle Mansuy.
Alarmzeichen erkennen und behandeln
So ist zum Beispiel eine Kohortenstudie mit über hundert Medizinstudierenden geplant, die ihr Praktikum in einem stressintensiven medizinischen Umfeld absolvieren, zum Beispiel in der Notaufnahme, der Intensivstation, der Inneren Medizin oder der Onkologie. Sechs Monate nach Beginn des Praktikums werden Angst, Depressionssymptome, psychosoziale Funktionsfähigkeit und wahrgenommener Stress als «stressbezogene psychopathologische Manifestationen» erfasst. Weitere Befragungen im Laufe einer längeren Zeitspanne ermöglichen Bestimmung und Vergleich individueller Gesundheitsverläufe innerhalb der Kohorte.
Dies ist eine leicht veränderte Fassung eines Artikels von Marita Fuchs, welcher zuerst in den «UZH News» erschienen ist.