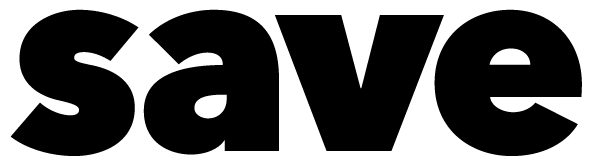Zivilschutz neu gedacht
Die sicherheitspolitische Lage hat sich grundlegend verändert – Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und Klimakrise fordern den Bevölkerungsschutz heraus. Michaela Schärer, Direktorin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, erklärt, wie der Zivilschutz neu ausgerichtet wird.

Frau Schärer, was sind die zentralen Neuerungen im kürzlich verabschiedeten Fähigkeitsprofil Zivilschutz?
Michaela Schärer: Die Überprüfung hat gezeigt, dass das bestehende Leistungsprofil weitgehend dem heutigen Bedarf entspricht. Neu wird jedoch auf Bundesebene ein Fähigkeitsprofil definiert, das die generellen Fähigkeiten des Zivilschutzes vorgibt. Die konkrete Ausgestaltung – inklusive Organisation und Bestände – bleibt Sache der Kantone.
Eine weitere wichtige Neuerung ist die Unterscheidung zwischen Kern- und erweiterten Fähigkeiten. Erstere müssen alle Kantone sicherstellen, Letztere bilden den erweiterten Rahmen und können in Kompetenzverbünden abgedeckt werden.
Zu beachten ist, dass Fähigkeiten im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten sowie im Bereich Sanitätsdienst aktuell noch in separaten Projekten überprüft und konkretisiert werden.
Warum war es notwendig, das bisherige Leistungsprofil zu überarbeiten?
Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und die stark veränderte sicherheitspolitische Lage, vor allem der Krieg in der Ukraine, haben es nötig gemacht, das Leistungsprofil zu überprüfen und anzupassen.
Wie wird sich das neue Fähigkeitsprofil konkret auf Ausbildung, Ausstattung und Einsätze des Zivilschutzes auswirken?
Kantone, die gewisse Fähigkeiten heute nicht mehr ausreichend abdecken, müssen diese (wieder) aufbauen und im Sollbestand ausweisen. Dabei müssen auch Ausbildung und Ausrüstung sichergestellt und gewährleistet werden, z.B. bei der Ortung und Rettung.
«Eine Bevölkerung kann im Kriegsfall zu einem wichtigen Faktor werden.»
Wie gelingt es, eine einheitliche Umsetzung in den verschiedenen Kantonen sicherzustellen?
An der Frühjahrssession hat das Parlament das revidierte Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz verabschiedet. Darin wird auch geregelt, dass die Kantone aufgrund ihres kantonalen Leistungsprofils und ihrer Organisationsstruktur die gewünschte Anzahl an Dienstpflichtigen für den Zivilschutz festlegen und dem BABS vorlegen müssen. Dieses Vorgehen erlaubt, in einem partnerschaftlichen Prozess auch den Stand der Umsetzung des Fähigkeitsprofils zu erörtern.
Welche Lehren zieht das BABS aus dem Krieg in der Ukraine im Hinblick auf die Resilienz der Schweizer Bevölkerung?
Neben Lehren in den Bereichen Schutzbauten, Alarmierung und Information der Bevölkerung, Zivilschutzeinsätze usw. eröffnet der Krieg in der Ukraine auch Einblicke, wie sich eine Gesellschaft erfolgreich an massive Veränderungen anpassen kann. Besonders hervorzuheben ist die Freiwilligenbewegung. Nach dem russischen Überfall im 2022 wurde deutlich, dass die ukrainischen zivilen Behörden wie der Zivilschutz rasch an ihre Belastungsgrenze stossen. Wo Lücken entstanden sind, organisierte sich die Bevölkerung zu einem hohen Grad selbständig. Sie hilft z.B. Opfern des Krieges und unterstützt Flüchtlinge im eigenen Land. Zudem unterstützt sie die zivilen Behörden bei der Verteilung von Hilfsgütern oder den Zivilschutz bei der Trümmerrettung nach Raketenangriffen. Dies zeigt, dass sich eine Bevölkerung im Kriegsfall stark solidarisieren kann und dadurch zu einem wichtigen Faktor bei der Bewältigung eines bewaffneten Konflikts wird. Das BABS ist überzeugt, dass gerade in der Schweiz mit seiner ausgeprägten Vereins- und Milizkultur diesbezüglich ein grosses Potenzial vorliegt. Es stellt sich die Frage, wie optimale Rahmenbedingungen geschaffen werden können, damit dieses Resilienzpotenzial im Falle der Fälle zum Tragen kommen kann.
Welche Bedeutung kommt dabei der Modernisierung von Schutzbauten zu?
Die Schweiz verfügt über ein flächendeckendes Schutzbautensystem mit Schutzräumen für die Bevölkerung sowie Schutzanlagen für die Führungsorgane und den Zivilschutz. Sie bilden die zentrale Infrastruktur zum Schutz der Bevölkerung. Der Werterhalt der Schutzbauten ist also zentral.
Wird im Bevölkerungsschutz nun verstärkt auch auf Szenarien bewaffneter Konflikte fokussiert?
Ja. Mit dem Beginn des Ukrainekriegs ist der bewaffnete Konflikt wieder in den Fokus gerückt. Das BABS schafft hierzu die entsprechenden Grundlagen mit dem Projekt «Bevölkerungsschutz im bewaffneten Konflikt». Wichtig zu erwähnen ist, dass ein bewaffneter Konflikt heute nicht mehr gleich abläuft wie früher. Besonders die hybride Konfliktführung, wie Cyberangriffe, Sabotage oder Spionage, beginnt weit vor einem eigentlichen bewaffneten Angriff. Trotzdem dürfen die Fähigkeiten zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen nicht geschwächt werden, wie die zunehmenden klimabedingten Ereignisse zeigen.
Wie beurteilen Sie das Potenzial von Spontanhelfenden im Krisenfall?
Das Potenzial für den Einsatz von Spontanhelfenden bei einem Ereignis ist gross. Das BABS hat dieses Potenzial erkannt und wird Grundlagen erarbeiten, wie dieses genutzt werden kann.
Welche Herausforderungen bestehen bei ihrer Integration in bestehende Strukturen?
Herausforderungen sind etwa die Registrierung und der Empfang, die Koordination der Einsätze und die Zuteilung von Aufgaben, die Lenkung und Führung im Einsatz, Sicherheits- und Haftungsfragen, Logistik, zum Beispiel Verpflegung und Unterkunft, Ausbildung (ad hoc) und – ein zentraler Punkt – die Kommunikation und Information. Wichtig ist, dass Spontanhelfende mit ihren Fähigkeiten am richtigen Ort und zur richtigen Zeit eingesetzt werden können – ohne sich selber oder die Einsatzkräfte zu gefährden.

Gibt es bereits bewährte Modelle oder Pilotprojekte in der Schweiz zur Koordination von Spontanhelfenden?
Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie etwa Deutschland, Belgien oder Spanien hat die Schweiz noch relativ wenig Erfahrung im Umgang mit Spontanhelfenden. Daher bildet dieses Thema auch eines der Handlungsfelder der «Fähigkeitsanalyse Bevölkerungsschutz», die im Juni 2024 vom Bundesrat verabschiedet wurde (1). Eine Arbeitsgruppe des BABS bearbeitet dieses Handlungsfeld zusammen mit den Kantonen und dem SRK. Beim SRK sind die Spontanhelfenden nämlich ein wichtiges Thema, und es hat auch entsprechende Erfahrungen.
Es gibt Kantone, die in der Praxis schon Erfahrungen mit Spontanhelfenden gemacht haben, so etwa im letzten Jahr der Kanton Tessin bei der Bewältigung der Unwetter im Maggiatal.
«Mit dem Beginn des Ukrainekriegs ist der bewaffnete Konflikt wieder in den Fokus gerückt.»
Was sind die grössten Chancen, aber auch Risiken bei der Digitalisierung des Zivilschutzes?
Mit dem Projekt Digitalisierung Zivilschutz (DIZIS) soll vor allem der administrative Aufwand verringert sowie Kommunikation und Interaktion zwischen den Dienstpflichtigen und den Zivilschutzstellen erleichtert werden. Das Projekt erfolgt über eine gemeinsame Plattform für Armee und Zivilschutz. Somit können Synergien optimal genutzt werden.
Wie weit ist das Projekt DIZIS fortgeschritten und welche konkreten Schritte stehen als nächstes an?
DIZIS wird in zwei Phasen umgesetzt: In der Phase 1 (2025 – 2026) geht es primär um die Digitalisierung der administrativen Prozesse mit Fokus auf die Ablösung des physischen Dienstbüchleins durch den elektronischen Dienstmanager (DIM). In der Phase 2 ab 2026 sollen interaktive Prozesse zwischen den kantonalen Zivilschutzstellen und den Zivilschutzangehörigen implementiert werden. Dazu gehören Gesuche um Dienstverschiebung und Urlaub sowie das digitale Aufgebot.
Wie wird die Bevölkerung in Zukunft besser informiert, sensibilisiert und einbezogen?
Den für die Ereignisbewältigung zuständigen Behörden stehen für die Information der Bevölkerung unter anderem die Alertswiss-Kanäle zur Verfügung. Dort fliessen nicht nur die relevanten Informationen bei Ereignissen in der Schweiz zusammen, sondern es gibt auf der Website wie auch in der App ebenfalls Empfehlungen zur individuellen Vorsorge. So besteht die Möglichkeit, einen personalisierten Notfallplan zu erstellen, der hilft, schnell und richtig zu reagieren. In der strategischen Ausrichtung des BABS zur Information, Warnung und Alarmierung der Bevölkerung ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Alertswiss-App und -Website vorgesehen. Ein Schwerpunkt dieser Weiterentwicklung ist unter anderem die Verfügbarkeit von wichtigen Informationen auf dem Smartphone ohne Netzverbindung (bspw. das Anzeigen der Notfalltreffpunkte).
(1) news.admin.ch/de/nsb?id=101580