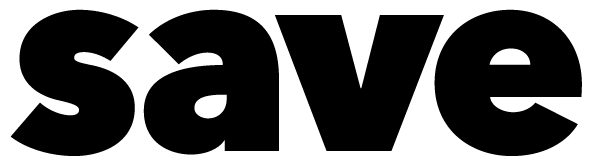Hirnsignale für Wirkstoff-Screening
Ein internationales Team unter Leitung von ETH-Forschenden hat eine Technik entwickelt, um den Effekt von Wirkstoffen am Gehirn mithilfe von elektrischen Hirnsignalen genauer zu beurteilen. Das könnte besonders in der frühen Entwicklungsphase von Medikamenten gegen Epilepsie von Nutzen sein.

Für Hirnkrankheiten gibt es noch immer vergleichsweise wenige Therapien. Das liegt unter anderem an der schwierigen Entwicklung neuer Medikamente, denn die Wirkungen und Nebenwirkungen einer Substanz am Gehirn lassen sich nicht so einfach nachweisen. Standard in der Medikamentenforschung sind Verhaltensstudien an Nagetieren. Dabei geben Forschende den Tieren einen neuen Wirkstoff und dokumentieren deren Verhaltensmuster. Diese Studien sind wichtig, doch bei der Suche nach neuen Wirkstoffen im Hochdurchsatz-Screening sind sie ungeeignet. Bei diesem Verfahren, das unter anderem in der Pharmaindustrie zum Einsatz kommt, werden Zehntausende Substanzen parallel getestet. Das ist mit Verhaltensbeobachtungen an Nagetieren nicht möglich.
Mehmet Fatih Yanik, Professor am Labor für Neurotechnologie, hat deshalb mit einer internationalen Arbeitsgruppe ein neues Testmodell entwickelt. Damit kann man die Wirkungen und Nebenwirkungen von mehreren Substanzen gleichzeitig und in grosser Zahl untersuchen. Die Forscher berichten darüber in der Fachzeitschrift Nature Communications.
Ins Gehirn geschaut
«Das Gehirn besteht aus hochkomplexen, vernetzten Strukturen, die auf vielschichtige Weise miteinander kommunizieren», erklärt der Physiker und Ingenieur Yanik. Beim Menschen können diese Signale von der Schädeloberfläche abgeleitet werden. Informationen vieler Nervenzellen werden zu einer Hirnstromkurve, dem Elektroenzephalogramm (EEG), zusammengefügt. Ärzte nutzen diese Wellenmuster, um Schlaf zu analysieren, Krankheiten wie Epilepsie zu erkennen oder die Wirksamkeit von Medikamenten zu testen. Bei der frühen Entwicklung von neuen Wirkstoffen gegen Hirnkrankheiten fehlte bisher ein vergleichbares Werkzeug.
Yanik und sein Team suchten deshalb nach einer Möglichkeit, um die Hirnaktivitität anhand elektrophysiologischer Signale auszulesen und zu analysieren. Bei Larven vom Zebrafisch als Modellorganismus wurden sie fündig. Die fast durchsichtigen Larven sind mit ihren zwei Millimetern Körperlänge winzig. Dadurch ist es möglich, viele von ihnen parallel zu untersuchen. Die Forschenden platzierten die Larven in einem Gel in dünnen Glasröhrchen, sodass sie sich für die Dauer des Versuchs nicht bewegten. Durch diesen Trick gelang es den Forschenden, die Elektroden zur Ableitung der elektrischen Hirnsignale direkt im Gehirn der Larven anzubringen: Dadurch gelingt es ihnen, die Information direkt dort auszulesen, wo sie entsteht.
Epilepsieauslöser nachgestellt
In ihren Experimenten verwendeten die Wissenschaftler Larven, die eine Mutation am SCN1A-Gen haben. Bei Menschen ist diese Veränderung mit verschiedenen Formen der Epilepsie im Kindesalter gekoppelt wie dem Dravet-Syndrom. Kinder mit Dravet-Syndrom erleiden bereits im ersten Lebensjahr schwere epileptische Anfälle und haben häufig eine verzögerte geistige Entwicklung. Die Anfälle lassen sich nur schwer mit Medikamenten behandeln und können unter anderem durch Licht ausgelöst werden.
Dieselbe Lichtempfindlichkeit haben Yanik und sein Team nun bei den Larven mit der SCN1A-Genmutation nachgewiesen. Die Forschenden setzten die Larven im Experiment Lichtblitzen aus und erfassten die elektrischen Signale, die den Zellzwischenräumen von nahe beieinander liegenden Nervenzellen entstammen. Im Prinzip ist das, als ob man sich in eine Telefonzentrale setzte und die Kommunikation der umliegenden Telefone belauschte. Mit einem neu entwickelten Algorithmus werteten die Forschenden die Signale aus dem Gehirn aus. «In unseren Experimenten an den Larven mit Gendefekt haben wir die typischen Signale gefunden, die bei Anfällen auftreten. Das war bei den gesunden Larven nicht der Fall», berichtet Yanik.
Gesunde Vielfalt im Gehirn
Während bei den gesunden Zebrafischlarven vielschichtige lokale Hirnaktivitätsmuster aufgezeichnet wurden, waren diese bei den Larven mit Gendefekt viel einfacherer Natur. Das entspricht Beobachtungen am Menschen, wonach Hirnströme bei Patienten mit Parkinson oder Schizophrenie weniger komplex sind. Je vielschichtiger Nervenzellen miteinander kommunizieren, desto gesünder scheint das Gehirn.
Wenn es nun gelänge, mit Wirkstoffen die Komplexität von Hirnsignalen zu erhöhen und dies als therapeutisches Ziel zu definieren, hätte man endlich einen Messparameter direkt aus dem Gehirn, um Wirkungen und Nebenwirkungen chemischer Substanzen zu bewerten, ist Yanik überzeugt. Das wäre in der Arzneimittelforschung ein grosser Fortschritt.
Text: ETH